
Von Marius Schwarze
Etwa 60 Menschen hatten sich am Sonntag, 21. März, an der Dortmunder Reinoldikirche versammelt. Veranstalter war die Organisation „Seebrücke“. Die Gruppierung ist bundesweit vertreten und ruft immer wieder zu Aktionen und Demonstrationen auf. Ihr Kernthema: die Situation von Flüchtlingen im Mittelmeerraum, wo jährlich noch immer hunderte Menschen ihr Leben verlieren, bei dem Versuch aus ihren Herkunftsländern nach Europa zu gelangen.
„Iuventa-Crew“ vor italienischem Gericht wegen „Beihilfe zu illegaler Einwanderung“ angeklagt
Zu Beginn der Kundgebung spielten die Veranstalterinnen eine Sprachnachricht von Dariush Beigui, Kapitän der „Iuventa“, Angeklagter wegen Beihilfe zu illegaler Einwanderung, ab. Der Hamburger hatte im Sommer 2017 zusammen mit seiner Crew Flüchtlinge aus einem sinkenden Boot aufgenommen und an der sizilianischen Küste abgesetzt. ___STEADY_PAYWALL___

Daraufhin wurde das Schiff beschlagnahmt und die Crew festgenommen, der Grund: Beihilfe zu illegaler Einwanderung. Eine Situation, wie sie sich auch heute noch oft im Mittelmeerraum abspielt. „Schon seit Jahren zeigen wir auf diese wunden Stellen, und wir werden erst aufgeben, wenn sich etwas geändert hat“, verkündete Darius.
Seit September 2018 sind er und andere der Iuventa-Crew offiziel angeklagt. Im Jahr 2020 kam dann der Brief zu ihm nach Hamburg. „Es ist eine ganz unbekannte Situation für mich als Angeklagter vor Gericht zu stehen“, kommentierte Darius die Anklage. Insgesamt werden mit Darius 21 weitere Crew-Mitglieder von der Organisation „Jugend rettet“ angeklagt.
Nicht nur die Iuventa-Cew setzt sich für das Überleben und die Rettung der Flüchtlinge im Mittelmeer ein. Mit der Zeit sind es immer mehr Organisationen geworden, und immer mehr Menschen werden auf die Problematiken aufmerksam und versuchen sich zu engagieren. Ein weiteres Beispiel sind „Ärzte ohne Grenzen“, die sich nicht nur seit Jahren in Ländern Afrikas für eine bessere gesundheitliche Versorgung der Menschen einsetzen, sondern auch in Camps für Geflüchtete die nötige medizinische Versorgung sicherstellen.
Kritik an der Verharmlosung rechtsextremen Terrors in Deutschland

Ein Mitglied der DiDF (Föderation demokratischer Arbeitervereine/türkisch: Demokratik İşçi Dernekleri Federasyonu) hatte einen Redebeitrag vorbereitet, in dem rassistische Übergriffe thematisiert wurden. Zahlreiche gab es davon in den letzten Jahren, hierzu solle nicht nur Hanau oder Halle in Erinnerung gerufen werden.
Hier hätten Rechtsterroristen gezielt Menschen mit Migrationshintergrund angegriffen. „Ich möchte an die Taten in Hanau und Halle erinnern, die einmal mehr zeigen wie organisiert diese Verbrechen vonstatten gehen“, sagte ein junges Mitglied der Organisation. Medial sei auch in diesem Fall von einem psychisch kranken Einzeltäter die Rede gewesen. Für die DiDF Jugend keineswegs ein Einzelfall und auch nicht Ergebnis einer Krankheit. Vielmehr sollten die Behörden ihrer Meinung nach strukturierter gegen Gewalttaten diesen Ausmaßes vorgehen, und es nicht als Einzeltat abtun.
„Die Verharmlosung des rechten Terrors nimmt so weiter ihren Lauf“, fasst der Sprecher der DiDF Jugend zusammen. Darüber hinaus kritisieren sie die Verstrickungen deutscher Behörden und Amtsträger in die rechte Szene. Als Beispiel hierfür seien die NSU Prozesse hervorzuheben, in denen laut der DiDF Jugend systematischer rechter Terror betrieben wurde und auch heute immer noch in ähnlich Funktionen wird. „Nicht zuletzt wegen Vorfällen wie dem NSU Prozess, verlangen wir lückenlose Aufklärung“, bekräftigt der Sprecher seine Forderung, den rechten Terror zu stoppen und systematisch zu bekämpfen.
„Nicht Geflüchtete, sondern Fluchtursachen müssen bekämpft werden“
Rassismus in einzelnen Ländern spiegelt sich auch an den Grenzen Europas wieder. „Der Hass und die Angst gegen vermeintlich Fremde wird vor allem an den Grenzgänger geschürt“, erklärt der Sprecher der DiDF Jugend. Es sei nicht nachvollziehbar dass Menschen, die aus verschiedensten Gründen aus ihren Herkunftsländern flüchten, an Grenzen abgewiesen würden.

Vor allem der Mittelmeerraum sei hervorzuheben. Es könne nicht sein, dass trotz gesellschaftlicher Aufrufe angesichts der im Mittelmeer ertrinkenden Menschen, noch immer Boote aus Häfen verwiesen würden und nicht über die Grenzen gelassen würden. „Nicht Geflüchtete, sondern Fluchtursachen müssen bekämpft werden“.
Angesichts der Exporte von Waffen in viele Länder, in denen Krieg herrscht, weist der Sprecher der DiDF Jugend daraufhin, dass es nicht die Geflüchteten, sondern die Zustände in den jeweiligen Ländern seien, die sich ändern müssten. Die Forderung der DiDF Jugend sei klar, es müssten mehr Fluchtwege geöffnet werden und die an den Grenzen zu Europa liegenden Unterkünfte für Geflüchtete seien zu evakuieren.
Neben der Seebrücke und dem DIDF waren in Dortmund unter anderem der Flüchtlingspaten Dortmund e.V., Grenzenlose Wärme, Offenes Zentrum Dortmund, der Planerladen,, der AStA der TU Dortmund, das Bündnis Dortmund gegen Rechts und weitere an der Aktion zu Internationalen Tag gegen Rassismus beteiligt.
Historischer Hintergrund zum Internationalen Tag gegen Rassismus
Der 21. März wird seit 1966 von den Vereinen Nationen als der Internationale Tag gegen Rassismus ausgerufen. Grund für den Tag sind die Geschehnisse aus dem Jahr 1960 von Sharpeville in Südafrika. Damals waren per Gesetz alle dunkelhäutigen Bürger*innen der südafrikanischen Stadt dazu verpflichtet einen Pass mit sich zu tragen, der Auskunft über den Arbeitsplatz und die Herkunft gab.
Dieser Pass musste immer bei sich getragen werden. Mit diesen Pässen konnte die damalige Regierung die Wohnviertel der „weißen“ von den Industriegebieten und damit den Wohnvierteln der „Schwarzen“ trennen.
An diesem 21 März 1960 gingen Tausende auf die Straße und versammelten sich vor dem Southafrican Policedepartement von Sharpeville. Bewusst hatten sie ihre Pässe an diesem Tag nicht dabei und demonstrierten für Gleichberechtigung. Nachdem die Proteste zunächst friedlich verliefen, flogen irgendwann vereinzelt Steine Richtung Polizeirevier. Daraufhin eskalierte die Situation und es wurde ein polizeilicher Schießbefehl erteilt.
69 Menschen, darunter acht Frauen und zehn Kinder kamen im Maschinengewehrfeuer ums Leben, viele von ihnen wurden von hinten erschossen. Viele weitere Demonstrant*innen wurden verletzt und später festgenommen. Der Vorfall löste weitere Proteste im Land aus, so dass am 30. März 1960 der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. International kritisierte man die Regierung Südafrikas für ihren Umgang mit der schwarzen Bevölkerung und Rufe nach einem Ende der Apartheid wurden lauter.
Es sollte jedoch noch über 30 Jahre mit teils derben Konflikten und blutigen Auseinandersetzungen dauern, bevor es 1994 zu den ersten allgemeinen, gleichen und geheimen Wahlen in Südafrika kam. Am 21. März 1996 dann unterzeichnete der damalige Präsident Nelson Mandela die neue südafrikanische Verfassung in Sharpeville.
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:



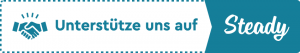


Reaktionen
Aktionen zum Weltflüchtlingstag in der Stadtkirche St. Reinoldi – Jeder Mensch hat einen Namen (PM)
Aktionen zum Weltflüchtlingstag in der Stadtkirche St. Reinoldi – Jeder Mensch hat einen Namen
Schon im Jahr 1914 wurde international erstmals ein Gedenktag für Menschen auf der Flucht ausgerufen. Heute, 107 Jahre später, ist das Problem von Flucht und Migration evidenter denn je zuvor. Zum diesjährigen Weltflüchtlingstag am 20. Juni veranstaltet die Evangelische Stadtkirche St. Reinoldi eine Reihe von Veranstaltungen.
Sie nimmt damit eine Aktion auf dem Deutschen Evangelischen Kirchentag vor zwei Jahren in Dortmund auf, die bundesweit für große Resonanz gesorgt hatte. Unter dem Motto ‚Jeder Mensch hat einen Namen‘ hatten zahlreiche Besucherinnen und Besucher des Kirchentages auf dem ‚Platz der Alten Synagoge‘ die Namen von Menschen, die bis zu diesem Zeitpunkt auf ihrer Flucht im Mittelmeer ertrunken waren, auf ein großes Transparent geschrieben. Anschließend trugen sie das Namenstransparent gemeinsam zur Reinoldikirche und zogen es dort als mahnendes Zeichen am Kirchturm empor.
35.597 Namen zählte das Transparent auf dem Kirchentag vor zwei Jahren. Mittlerweile sind es mehr als 44.000 Menschen, die bei ihrem Versuch, nach Europa zu fliehen, gestorben sind. Die meisten von ihnen, Männer, Frauen, Jugendliche, Kinder, Babys, ertranken im Mittelmeer. Noch immer ist keine Lösung für die Flüchtlingstragödie gefunden worden. Auf diesen Skandal und die erbärmliche Lage hunderttausender Menschen auf der Flucht will St. Reinoldi mit ihren Veranstaltungen zum Weltflüchtlingstag hinweisen.
Am Freitag, 18. Juni, sind im um 18 Uhr im Rahmen des Abendgebets in St. Reinoldi literarische Texte von Geflüchteten zu hören. Gebet und Lesung tragen den Titel: ‚Einen Fremden sollst du nicht bedrücken … (aus dem 3. Buch Mose)‘. Es lesen Autor*innen, die sich im Projekt ‚nid‘ (Neu in Deutschland – ein literarisches Demokratieprojekt, Bochum) engagieren. Stadtkirchenpfarrerin Susanne Karmeier gestaltet den liturgischen Rahmen, Mouaz Alsirieh (Fagott), Ari Masto (Gitarre) und Reinoldikantor Christian Drengk (Klavier) machen die Musik.
Am Samstag, 19. Juni, gibt es in St. Reinoldi in der Zeit von 11 – 14 Uhr ein Totengedenken. Unter dem Titel ‚Jeder Mensch hat einen Namen‘ werden Namen von Menschen verlesen, die auf der Flucht verstorben sind, sowie Ort und Umstände ihres Todes. Zu jeder halben Stunde gibt es einen Moment der Stille und des Innehaltens.
Am Sonntag, 20. Juni schließlich findet jeweils um 10 Uhr und um 11.30 Uhr in der Stadtkirche ein Gottesdienst zum Weltflüchtlingstag statt. Die Gottesdienste stehen unter dem Motto aus dem Buch Ruth: „Wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist. Ich bin doch eine Fremde?“ Die Predigt hält Superintendent i.R. Paul-Gerhard Stamm, Liturgie Stadtkirchenpfarrerin Susanne Karmeier, Musik: Mouaz Alsirieh (Fagott) und Kantor Christian Drengk (Orgel und Klavier).
Zudem lädt die Dortmunder Lokalgruppe der Internationalen Bewegung ‚SEEBRÜCKE‘ am Samstag um 13.30 Uhr im Westpark zu einer Aktion ‚Namen schreiben‘ ein. Unter dem Titel ‚Menschenrechte sind #unverhandelbar!‘ folgt gegen 15 Uhr ein Demonstrationszug zur Reinoldikirche.
Die Veranstaltungen:
Freitag, 18. Juni, 18 Uhr Abendgebet mit Lesung
Einen Fremden sollst du nicht bedrücken … (aus dem 3. Buch Mose)
Samstag, 19. Juni, zwischen 11 und 14 Uhr Totengedenken
„Jeder Mensch hat einen Namen“
Sonntag, 20. Juni, 10 Uhr und 11.30 Uhr Gottesdienst zum Weltflüchtlingstag
„Wie kommt es, dass du so freundlich zu mir bist. Ich bin doch eine Fremde?“
(aus dem Buch Ruth)
—
SEEBRÜCKE Dortmund:
Samstag, 19. Juni ab 13.30 Uhr – Kundgebung und Demonstration:
Menschenrechte sind #unverhandelbar!
Wir klagen an! – Menschenrechte sind #Unverhandelbar – Bundesweiter Aktionstag am 19. und 20. Juni in Dortmund (PM)
Wir klagen an! – Menschenrechte sind #Unverhandelbar –
Bundesweiter Aktionstag am 19. und 20. Juni in Dortmund
Am 19.06.2021 um 13.00 Uhr ruft die Seebrücke Dortmund zu einer Kundgebung auf. In ganz Deutschland finden rund um den Weltflüchtlingstag am 20. Juni Veranstaltungen unter dem Motto “Wir klagen an! – Menschenrechte sind #Unverhandelbar“ statt. Ab 13 Uhr werden im Westpark neben der Seebrücke Dortmund verschiedene Dortmunder Initiativen ihre Forderungen, darunter die sofortige Evakuierung aller Lager an den EU-Außengrenzen, staatlich organisierte Seenotrettung sowie die Gewährleistung des individuellen Rechts auf Asyl. bekannt geben. Menschenrechte dürfen nicht weiter als Verhandlungsmaße und Spielball der Parteien und Politiker*innen benutzt werden.
Um die Dringlichkeit der Forderungen und die Notwendigkeit des Schutzes von Menschenleben besonders zu betonen, wird eine Aktion des evangelischen Kirchentags 2019 weitergeführt: So werden Banner mit den Namen ertrunkener Menschen gefertigt, die bei der anschließenden Laufdemo durch die Innenstadt getragen werden.
Die Einhaltung gesundheitlicher Hygienemaßnahmen wird von den Veranstalter*innen durch Abstandsregelungen und das obligatorische Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes aller Teilnehmer*innen sichergestellt.
Die SEEBRÜCKE ist eine breite zivilgesellschaftliche Bewegung, die sich für die zivile Seenotrettung, für sichere Fluchtwege und für die dauerhafte Aufnahme von geflüchteten Menschen in Deutschland einsetzt.