
Es soll nicht nur ein zentraler Ort für die Hinterbliebenen jener werden, die Hand an sich legten. Mit der symbolischen Pflanzung eines Ginkgobaums – am Dienstag, den 10. September, im Stadewäldchen – will das Krisenzentrum Dortmund ebenso ein Thema stärker in die öffentliche Aufmerksamkeit rücken, das gesellschaftlich beständig tabuisiert wird. Nicht zuletzt, um dafür zu sensibilisieren, am Verhalten von FreundInnen oder Verwandten Anzeichen zu erkennen, wenn sie vielleicht Suizidgedanken in sich tragen. Um dadurch überhaupt Fragen, ein Gespräch zu ermöglichen. Vielleicht Hilfen in einer oft scheinbar ausweglosen Situation anbieten zu können. Auf diese Weise einen nahestehenden Menschen zu ermutigen, zu bleiben. Weil jedes Wesen so wertvoll ist und die Zurückgebliebenen leiden werden. Die Entscheidung allerdings, ist sie freien Willens, kann am Ende denen, die gehen wollen, niemand abnehmen – auch nicht mit staatlicher Gewalt.
Suizidalität und Tod: Gegenstand individueller wie gesellschaftlicher Verdrängung
Ein Mensch tötet sich selbst. Angehörige, Freunde sind schockiert, fassungslos, hilflos. Was geschehen ist, bleibt im ersten Moment unbegreiflich, und wird es in bestimmter Hinsicht immer bleiben: dass da jemand unter uns irgendwo zwischen innerem Zwang und freier Entscheidung von eigener Hand starb. Wo wir alle den Tod – und insbesondere das Sterben zu ihm hin – doch so sehr fürchten. Und ihn aus diesem Grund individuell wie gesellschaftlich sorgfältig verdrängen.
___STEADY_PAYWALL___
Weil wir uns inmitten des Lebens nicht mit einem Gegenpol menschlicher Selbstgegebenheit auseinandersetzen wollen – dem Nichts. Denn vom eigentlichen Tot-Sein hat noch niemand berichtet. Insofern ist Suizidalität – d.h. sich ernsthaft mit dem vorzeitigen Ableben als einer radikalen Ausstiegsmöglichkeit zu beschäftigen – außergewöhnlich.
Doch andererseits sind Suizidgedanken in akuten persönlichen Krisen gerade nichts abnormales, abseitiges, sondern – bei starkem Leidensdruck und wahrgenommener Ausweglosigkeit – eine nicht ungewöhnliche Reaktion aus dem Alltag heraus, die mitnichten mit einer begleitenden psychischen Störung einhergehen müssen.
Suizidgedanken: keine Krankheit, sondern gehören zur normalen Reaktionsbildung in einer Lebenskrise
Wir haben also erst einmal überhaupt keinen „an der Waffel“, wenn bzw. nur weil wir sterben wollen. Diesen Umstand in die Öffentlichkeit zu tragen und Vorurteile über Suizidalität – dass sie abwegig, krankhaft sei – abzubauen, ist ein Hauptanliegen des Krisenzentrums Dortmund im Rahmen seiner Präventionsarbeit.
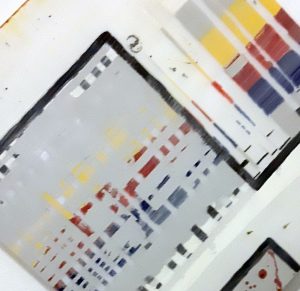 Es geht dem Team aus der Einrichtung in Hörde darum, jenen scheinbar dunklen Drang, anno dazumal „Selbstmordabsicht“ genannt, zu erhellen – ihn zu „normalisieren“. Das Suizidmotiv verständlich zu machen: als eine unter subjektiv extremen Umständen möglicherweise hervorgerufene Reaktionsbildung. Und es aus der Schmuddelecke und Tabuzone genauso herauszubekommen wie den Vollzug: die Selbsttötung. Neben den Verdrängungseffekten müssen dazu ideologische Reste christlicher Herrschaft beseitigt werden, die bis heute Seelen verirren, weil sie nicht heilen, sondern Schuldgefühle verstärken.
Es geht dem Team aus der Einrichtung in Hörde darum, jenen scheinbar dunklen Drang, anno dazumal „Selbstmordabsicht“ genannt, zu erhellen – ihn zu „normalisieren“. Das Suizidmotiv verständlich zu machen: als eine unter subjektiv extremen Umständen möglicherweise hervorgerufene Reaktionsbildung. Und es aus der Schmuddelecke und Tabuzone genauso herauszubekommen wie den Vollzug: die Selbsttötung. Neben den Verdrängungseffekten müssen dazu ideologische Reste christlicher Herrschaft beseitigt werden, die bis heute Seelen verirren, weil sie nicht heilen, sondern Schuldgefühle verstärken.
Als in Europa über Jahrhunderte unter anderem die Leichen der „Selbstmörder“ durch nachträgliche Folter geschändet und Tieren zum Fraß überlassen, das Vermögen von Verwandten eingezogen wurde. Es galt die vordergründige Auffassung, dass Gott den Menschen verbietet, sich das Leben zu nehmen, weil dies als ihr Schöpfer allein sein Privileg sei. Dass es als Geschenk in Besitz und Verfügung der Beschenkten übergeht, war gegenüber der eigentlichen Schmach aber unbedeutend: durch selbstbestimmten Abgang aus dem Leben sich weltlicher Herrschaft frühzeitig und unumkehrbar zu entziehen. Das konnte niemand wirklich wollen, sofern der Herr bzw. die Herren gegenwärtig blieben, auch wenn’s überall freudlos war.
In der Welt sterben jährlich mehr Menschen durch Selbsttötung als durch Kriegshandlungen
Die Rede ist mithin von einem gesellschaftlichen Problem, und zwar keinem geringfügigen, nicht nur aus historischen Gründen. Suizidalität und Suizid sollen auch heute stärker in die öffentliche wie individuelle Wahrnehmung gerückt werden. Warum? – Johannes Ketteler, Leiter der Dortmunder Einrichtung, nennt Zahlen, die aufhorchen lassen. Über 800.000 Menschen seien es jährlich, die sich weltweit suizidierten – mehr Opfer als es durch kriegerische Auseinandersetzungen gäbe.
In der Bundesrepublik sind es über 10.000 Selbsttötungen im Jahr, davon 50-60 in Dortmund. Kämen auf einen vollzogenen Suizid etwa zehn Versuche, so seien durch ihn zudem im Durchschnitt sieben weitere Menschen betroffen.
Diesen Hinterbliebenen, so Ketteler, könnte es extrem schwer fallen, den erlittenen Verlust zu verarbeiten. Wegen der Vorurteile gegenüber Selbsttötungen, der Angst, der Scham, über das Ereignis zu sprechen, mit Freunden oder Verwandten. Das aber ist in der Regel dringend nötig. Denn jene, die ungefragt zurückblieben, müssen sich meist mit vielen, drängenden und teils widerstreitenden Gefühlen auseinandersetzen.
Regelmäßige Gesprächsgruppe im Krisenzentrum für Hinterbliebene nach einem Suizid
Da ist der Schmerz, die Trauer über den plötzlichen Tod des geliebten Menschen; da ist Wut, „einfach“ zurückgelassen worden zu sein, die Scham, dass sich jemand, doch so nahestehend, aus der durch Vorurteile belasteten Perspektive der Gesellschaft „feige“ davonschlich.
 Vielfach begleitet von Ohnmachtsgefühlen, Hilflosigkeit. Selbstvorwürfe heben an, es nicht verhindert, Anzeichen im Vorfeld der Tat vielleicht nicht bemerkt oder sie nicht ernst genug genommen zu haben.
Vielfach begleitet von Ohnmachtsgefühlen, Hilflosigkeit. Selbstvorwürfe heben an, es nicht verhindert, Anzeichen im Vorfeld der Tat vielleicht nicht bemerkt oder sie nicht ernst genug genommen zu haben.
In einer solchen, im Einzelfall und nach individuellen Prädispositionen äußerst belastenden Lebenslage kann das regelmäßige Gespräch mit anderen Betroffenen zu einer bedeutenden Stütze werden.
Aus diesem Grund hat sich in dem Krisenzentrum vor sechs Jahren mithilfe einer Anschubfinanzierung des Rotary Clubs Dortmund die Themengruppe „Hinterbliebene nach Suizid“ gegründet.
Eine Hinterbliebene: am schmerzhaftesten sind die Schuldgefühle; sie zerreißen, mindestens anfangs
Hier kommen einmal wöchentlich Frauen und Männer zusammen, die ein ihnen gemeinsames Trauma verarbeiten: dass ein geliebter Mensch aus dem Leben ging, ohne hätte sterben zu müssen, wäre dazu nicht ein Wille oder ein dunkler Drang gewesen.
Aus der Hinterbliebenen-Gruppe sind zwei Frauen mittleren Alters beim Pressegespräch im Krisenzentrum an der Wellinghofer Straße in Dortmund-Hörde anwesend. Beide erlitten vor einiger Zeit diesen schweren Schicksalsschlag. Verloren nahe Angehörige, Menschen, die sie liebten – und die sich selbst töteten: hier ein Lebenspartner, dort ein Sohn. Sie erzählen ihre Geschichte, möchten verständlicherweise anonym bleiben. Es sind bewegende Worte, durch die tiefe Verletzung immer noch klingt.
Schuldgefühle seien die schmerzhaftesten, die man haben könnte, sagt die Frau, die um ihren Sohn trauert, mit brüchiger Stimme. Übers Reden habe ihr die Gruppe geholfen. „Es geht Schritt für Schritt weiter. Aber es ist nichts mehr so, wie es war. Es ist alles anders geworden.“ Das betrifft vielleicht auch die Schuldgefühle: sie zerreißen nach den vielen Gruppenstunden jetzt nicht mehr so.
Es wird immer eine Lücke bleiben – die Trauer kann daher nie vollständig verschwinden
Menschen wie sie bedürfen dringend professioneller Unterstützungsangebote, um das Erlebte nach und nach verarbeiten zu können. Dr. Werner Greulich, erfahrener Trauerberater, ist seit vier Jahren fachlicher Leiter der Gesprächsgruppe.

„Trauer braucht einen Ort und ein Wort, das gesprochen wird – zu einem Anderen, der mitfühlt“, erklärt er deren Bedeutung, die damals über den Freundes- und Förderkreises des Kriseninterventionszentrums verstetigt werden konnte. Denn bis das soziale Umfeld bereit sei, zuzuhören, bräuchte es häufig seine Zeit.
Auch deshalb könnten gerade die hier ermöglichten Erfahrungen unter den Betroffenen selbst eine heilsame Wirkung entfalten.
Sie bestünde darin, dass TeilnehmerInnen ihre erschwerte Trauer annähmen und sagen könnten: „Meine Reaktionen sind normal – gemessen an dem, was ich erfahren habe“, verdeutlicht der Theologe und Germanist mit pastoralpsychologischer Zusatzausbildung, der lange Jahre in verschiedenen Funktionen bei der Telefonseelsorge tätig war.
Und warnt vor überzogenen Erwartungen: es käme nicht darauf an, nach einem halben Jahr alles losgelassen zu haben. Im Gegenteil: eine Lücke werde immer bleiben und insofern mit ihr die Trauer.
Symptome einer Posttraumatischen Belastungsstörung: plötzliche Gefühlsflut und Kontrollverlust
Zwischen fünf und acht Betroffene erscheinen durchschnittlich, Frauen und Männer im Alter von 25 bis 80 seien schon dabei gewesen. Sie alle leiden unter erschwerter Trauer. Denn der Verlust kam für sie unvermittelt, ohne vorangegangenen Abschiedsprozess wie bei einem „natürlichen“ Tod. Der Schock sitzt tief, die Hinterbliebenen hier im Krisenzentrum sind in der Regel traumatisiert.
Das hat erhebliche Konsequenzen für die Lebensqualität: typischerweise werden sie durch (für Außenstehende) nur geringfügige Anlässe immer wieder mit dem Verlustereignis konfrontiert. Und zugleich mit assoziierten Gefühlen bis zum etwaigen Kontrollverlust überflutet – so, als sei das Schreckliche gerade erst geschehen.
Es ist vor allem diese stark belastende Symptomatik einer Posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS), die sich durch die in der Betroffenengruppe angestoßenen Verarbeitungsprozesse deutlich abschwächen kann. Mit sich alleingelassen, drohte dagegen ein Leben in latenter Angst. Davor, hilflos und ohne es zu wollen, erneut dem schrecklichen Ereignis gegenüberzustehen.
Ort des Gedenkens und der Besinnung entsteht am kommenden Dienstag im Stadewäldchen
Das in dem Kreis erfahrene Mitgefühl aus gemeinsamer Betroffenheit hilft. Es erhöht die psychische Widerstandsfähigkeit bei Krisen und erlaubt den Rückgriff auf die Gesprächsgruppe als sozialer Ressource. Zumal die Beziehungen der Menschen, die hier hinkommen, nicht persönlich vorbelastet sind. Sie habe irgendwann jemand gebraucht, der nicht aus ihrem näheren Umfeld stamme, sagt etwa die Frau, die vor ungefähr zwei Jahren ihren damaligen Freund leblos auffand.
 Den Verlorengegangenen zu gedenken, ist ein wichtiger Teil des Trauerprozesses. Zugleich bedarf es erhöhter gesellschaftlicher Aufmerksamkeit, um Gefährdeten frühzeitig und besser helfen zu können. Ein Fokus ist hier jährlich der 10. September: der Welttag der Suizidprävention, ausgerufen erstmalig 2003 von der Weltgesundheitsorganisation zusammen mit der Internationalen Assoziation für Suizidprävention.
Den Verlorengegangenen zu gedenken, ist ein wichtiger Teil des Trauerprozesses. Zugleich bedarf es erhöhter gesellschaftlicher Aufmerksamkeit, um Gefährdeten frühzeitig und besser helfen zu können. Ein Fokus ist hier jährlich der 10. September: der Welttag der Suizidprävention, ausgerufen erstmalig 2003 von der Weltgesundheitsorganisation zusammen mit der Internationalen Assoziation für Suizidprävention.
In der Bundesrepublik werden zu diesem Anlass an über 20 Orten Veranstaltungen stattfinden, darunter auch in Dortmund. Das Krisenzentrum lädt deshalb am kommenden Dienstag für 17 Uhr auf die große Rasenfläche ins Stadewäldchen. Dort soll ein Gedenkort für die Hinterbliebenen eingerichtet werden; darüber wurde mit der Stadt nun Einigung erzielt.
Ginkgobaum ( = Lebensmut) wird eingepflanzt
Im Zentrum der Gedenkstätte wird ein Ginkgobaum stehen, der zum Internationalen Tag der Suizidprävention an Ort und Stelle eingepflanzt werden soll. Er symbolisiert den Initiatoren um das Krisenzentrum zufolge Stärke und Bodenständigkeit; ist demnach ein Zeichen für Lebensmut. Vor einem Jahr bereits bei einer kleinen Zeremonie dergestalt gewidmet, steht er nun in der Einrichtung bereit.
Seine Funktion ist eine doppelte: „Der Baum soll all denen als Gedächtnisort dienen, die einen Menschen durch Suizid verloren haben und gleichzeitig das oft tabuisierte Thema Suizid in das öffentliche Bewusstsein rücken“, heißt es seitens der Veranstalter. Begleitet wird die Einpflanzung von einigen Ansprachen, angemessener Musik und einem Ritual des Eingedenkens.
An dem Baum selbst solle eine Tafel angebracht werden, mit der auf das Thema aufmerksam gemacht, auch Hilfsangebote verschriftlicht würden, erläutert Ketteler. Denn leider tauche es ansonsten nur auf, hätte sich jemand umgebracht. – Worum es hier geht: indem stärker ins gesellschaftliche Bewusstsein übergeht, dass Suizidgedanken aus dem Alltag heraus Normalität sind bzw. dies so respektiert wird, sinkt die Schwelle, jemanden anzusprechen, der oder die Anzeichen zeigt, sich mit dem berühmten „Sprung ins Nichts“ (Jean Améry) vielleicht zu beschäftigen.
Zwischen Trauerorten und Suizidprävention: wohlgemeinte Unterstützungsangebote fürs Leben
Im schlimmsten Fall könnte eine vertane Chance, als ein suizidaler Mensch vielleicht noch zu erreichen war, fatale Folgen haben. – Unabweisbar ist hier allerdings auch ein besonderer Umstand. Dieses, für Hinterbliebene und deren Trauerarbeit so wichtige Gedenken verweist insofern auf ein Spannungsverhältnis, als die Errichtung des Dortmunder Gedächtnisortes öffentlicher Teil der von Staat, Wohlfahrtverbänden und zivilgesellschaftlichen Initiativen organisierten Präventionsarbeit ist.
Damit sind Beweggründe und Ziele der Beteiligten teils auf zwei verschiedenen Ebenen angesiedelt. Hier die Trauer um die Verstorbenen und die möglichst früh einsetzende Bereitstellung einfühlsamer Hilfen bei Suizidalität. Auf dass nicht noch mehr Menschen sich genötigt sehen, diesen wohl einsamsten aller Wege gehen müssen, obwohl da Alternativen waren.
Dort die feste Intention, aus diesem Grund möglichst viele Selbsttötungen – wie und wenn irgend möglich – zu verhindern und die betreffenden Menschen mit Selbsttötungsabsichten im Leben zu halten.
Ein Motiv, das im Extremfall paternalistisch wird, weil es lückenlos, in jedem Augenblick um ein basales Gut für einen jeden Menschen weiß: den Wert seines eigenen Lebens, das zu erhalten ist – mindestens aber nicht eigenmächtig beendet werden darf. Was gegebenenfalls auch gewaltsam zu verhindern wäre. Das aber ist nicht ganz unproblematisch, weil letztendlich alle potentiellen SuizidentInnen über einen Kamm geschoren werden.
Krisenzentrum Dortmund: niederschwellige, kostenfreie Beratung in akuten Lebenskrisen
Doch bevor es in Ausnahmefällen überhaupt soweit kommen kann, treten Menschen in einer sie bedrängenden persönlichen Krise eben zunächst in ihrem sozialen Umfeld, in der Gesellschaft auf.
 Weil sie keinen Ausweg innerhalb ihrer Lebenswelt mehr sehen, wie sie dem dauernden Leidensdruck entkommen können, tragen sie vielleicht insgeheim schon den Gedanken in sich, frühzeitig zu scheiden; vielleicht erschrecken sie deswegen vor sich selbst.
Weil sie keinen Ausweg innerhalb ihrer Lebenswelt mehr sehen, wie sie dem dauernden Leidensdruck entkommen können, tragen sie vielleicht insgeheim schon den Gedanken in sich, frühzeitig zu scheiden; vielleicht erschrecken sie deswegen vor sich selbst.
Dass das in ihrer Situation normal ist, könnten auch sie sich idealtypisch sagen. Suchen sie sich sinnvollerweise Hilfe, landen sie unter Umständen bei einer dafür spezialisierten Anlaufstelle wie dem Krisenzentrum in Dortmund-Hörde. – Ist dem so, wird dergestalt angezeigt: eindeutig will hier niemand einfach so sterben, sonst wäre er/sie nicht hergekommen, um neue Perspektiven zu erlangen.
Was wird den Hilfesuchenden vor Ort geboten? – Einrichtungsleiter und Sozialpädagoge Ketteler fasst knapp zusammen: niederschwellige, kostenfreie Beratung für Menschen in akuten Lebenskrisen. Konkret wird ein Termin nach Anmeldung meist innerhalb der nächsten drei Tage vergeben, zu vereinbaren unter der Woche. Ein 24-Stunden-Notdienst ist nämlich nicht eingerichtet. Dafür gibt es andere Stellen, wie das LWL oder die Telefonseelsorge, unter anderem.
Suizidalität von Hilfesuchenden muss vor allem respektiert – und ernst genommen werden
Freilich: kaum dürften Menschen, die sich inmitten einer fundamentalen Krise befinden und ins Hörder Krisenzentrum kommen, besonders klaren Verstandes sein oder ausgestattet mit wohlgeordneten Emotionen. Sonst wären sie nicht dort, hätten sie sich und ihr Leben mit Übersicht im Blick.
Ein häufig anzutreffendes Merkmal sei vielmehr, erklärt Johannes Ketteler aus seiner langjährigen Erfahrung, dass die Leute in Gedanken und Gefühlen völlig unsortiert seien. Was das Krisen-Team dann zunächst nur tun kann: reden. Mit dem Primärziel: Deeskalation und Stabilisierung, um im Anschluss weitere individuelle Fähigkeiten und Ressourcen aktivierbar zu machen.
Dazu gehört zuallererst Akzeptanz gegenüber den Hilfesuchenden. Es müsse respektiert werden, dass jemand suizidal ist, betont der Einrichtungsleiter. Das folgt sowieso aus dem Normalitätsparadigma zum Aufkommen entsprechender Gedanken, ist aber auch pragmatisch geboten: um mögliche Abwehrreaktionen und etwaig entstehende Beratungsresistenzen zu vermeiden.
Im Einzelfall kann in dem Zentrum auch kurzzeitig und lösungsorientiert psychotherapeutisch geholfen werden. In schwerwiegenden Fällen mag der geschützte Raum einer Psychiatrie, einschließlich der dort möglichen medikamentösen Behandlung Voraussetzung sein, um sich zu sortieren und ein gewisses Maß an Autonomie und Handlungsfähigkeit wiederzuerlangen. Denn aus diesem Grund hatten die allermeisten hier vermutlich einen Termin vereinbart. Weil sie letztendlich leben wollen.
MitarbeiterInnen von Krisenzentren (z.B.) sind verpflichtet, KlientInnen vor Selbsttötungen zu schützen
Geht stattdessen gar nichts mehr, d.h. besteht (weiterhin, unvorhergesehenerweise etc.) die imminente Gefahr einer Selbsttötung, dann hätte das präsente Fachpersonal allerdings wenig Handlungsspielraum.
 Ihm bliebe nichts weiter übrig, als – aus der Beratungssituation heraus – zum Hörer zu greifen und umgehend eine Zwangseinweisung in die geschlossene Psychiatrie zu veranlassen. Das ist unschön, aber leider nicht zu ändern und hat zwei Gründe.
Ihm bliebe nichts weiter übrig, als – aus der Beratungssituation heraus – zum Hörer zu greifen und umgehend eine Zwangseinweisung in die geschlossene Psychiatrie zu veranlassen. Das ist unschön, aber leider nicht zu ändern und hat zwei Gründe.
Der eine liegt im geltenden Recht der Bundesrepublik. Darin wird eine besondere Pflicht festgelegt, die sich aus der Beziehung in professionellen Beratungs- oder Therapiesituation ergibt. Diese sog. Garantenstellung beinhaltet, gegenüber KlientInnen dafür zu sorgen, dass ein unerwünschter, sog. tatbestandlicher Erfolg nicht eintritt – die angekündigte Selbsttötung. Andernfalls käme es zu einem Unterlassungsdelikt mit entsprechenden strafrechtlichen (wie berufsständischen) Konsequenzen für behandelnde PsychologInnen, ÄrztInnen, usf.
Zweitens ist Suizid hierzulande zwar keineswegs verboten und deshalb nach rechtsstaatlichen Grundsätzen erlaubt. Dies gilt aber nur unter der Voraussetzung von Freiverantwortlichkeit: ich muss es aus meinem eigenen freien Willen heraus tun. – Wer aber wollte dies – und dann nach maximal einigen Beratungsgesprächen – abschließend beurteilen?
Suizidalität und „Tunnelblick“: oft ein Zusammenhang durch psychische Verengungssituation
Hinzukommt: empirische Studien der Suizidologie haben belastbar gezeigt, dass sich in sehr vielen Fällen suizidale Menschen in einer sog. psychischen Verengungssituation befinden, aus der heraus ihnen der Gang in den Tod lediglich als kleineres Übel erscheint. Weil ihnen in der Krise mit ihrem Tunnelblick lebensfreundliche Alternativen fast hermetisch verschlossen sind.
Daher existiert – trotz formeller Straffreiheit von Selbsttötungen – in der Bundesrepublik ein hinreichendes wie variables Inventar an legalen Möglichkeiten, bei akuter Selbstgefährdung ggf. auch gegen den expliziten Willen von Suizidären eine Realisierung ihrer Absichten unter Anwendung von Zwang zu verhindern. Von den Psychisch-Kranken-Gesetzen über das Betreuungsrecht bis hin zur Wahrung von Sicherheit und Ordnung nach den Polizeigesetzen der Länder. Alles kein Problem: wer sich selbst abservieren will, ist definitiv fällig.
Und zwar so oder so: ohne weitere Differenzierungskriterien. D.h.: selbst wenn in Grenzfällen der Selbsttötungsakt eindeutig autonom, d.h. freiverantwortlich motiviert wäre. Das interessierte schlicht niemanden; ich landete trotzdem in der Klapse – und würde unter Umständen solange zwangsfixiert oder medikamentös ruhig gestellt, bis ich wieder „zur Vernunft“ gekommen wäre.
Denn wir können – unter Verkennung existentieller Freiheit – als Gesellschaft grundsätzlich nicht wollen, dass Menschen sich eigenmächtig umbringen, weil wir damit unser eigenes Scheitern bzw. die Lückenhaftigkeit unseres „Werte“-Systems eingestünden, wo es weh tut: dort, wo seine BürgerInnen keinen anderen Weg mehr sehen, als vor ihm in den Tod, zur „ewigen Ruhe“ zu fliehen.
Der Trauer ihre Zeit lassen, die sie braucht – statt sie vorschnell als Krankheit zu stigmatisieren
Deshalb kann das für Gesundheit zuständige Versorgungssystem leistungsorientierter Gesellschaften manchmal gar nicht schnell genug reagieren, wo es verdächtige Abweichungen gibt, die funktionalistische Normvorgaben überschreiten, mit denen sukzessive und fast unmerklich ihr Kulturvorrat immer weiter aufgebläht wird. Konsequenz dessen ist beispielsweise die Tendenz zur Pathologisierung oder Psychiatrisierung menschlicher Verlustreaktionen wie die der Trauer in der Neuausgabe eines international anerkannten Diagnosehandbuch (DSM-5) aus den USA.
 Es stimme sie nachdenklich, bemerkt Dr. Anke Valkyser beim Pressetermin im Krisenzentrum – wenn in der Psychiatrie so klassifiziert bzw. pathologisiert würde. Diese ihre Worte kamen just, nachdem die beiden hinterbliebenen Frauen ihre Geschichte erzählt und über Unterstützungserfahrungen in der Gesprächsgruppe berichtet hatten. In der sie sich zur Trauerverarbeitung die Zeit nehmen können, die sie benötigen. Und niemand mit einem klugen Handbuch winkt, dass so was ja eigentlich schon ziemlich krank wäre: solange nicht vergessen zu können.
Es stimme sie nachdenklich, bemerkt Dr. Anke Valkyser beim Pressetermin im Krisenzentrum – wenn in der Psychiatrie so klassifiziert bzw. pathologisiert würde. Diese ihre Worte kamen just, nachdem die beiden hinterbliebenen Frauen ihre Geschichte erzählt und über Unterstützungserfahrungen in der Gesprächsgruppe berichtet hatten. In der sie sich zur Trauerverarbeitung die Zeit nehmen können, die sie benötigen. Und niemand mit einem klugen Handbuch winkt, dass so was ja eigentlich schon ziemlich krank wäre: solange nicht vergessen zu können.
Hier sei eben Hilfe wichtig, setzt die Leitende Ärztin der Psychiatrischen Institutsambulanz am Knappschaftskrankenhaus Lüdgendortmund klare Prioritäten. Das sieht der Freundes- und Förderkreis des Krisenzentrums Dortmund offenbar sehr ähnlich. Der Verein ist seit vielen Jahren – neben den Beiträgen seiner Mitglieder (von mind. 30 Euro jährlich) – auf Spenden angewiesen, um die Gesprächsgruppe der Hinterbliebenen weiter finanzieren zu können.
In diesem Jahr habe es einen Zuschuss von der Bezirksvertretung sowie von der Dortmunder Sparkasse gegeben, so der Vereinsvorsitzende, Rolf Glaser. Manchmal spendeten auch Menschen, denen im Krisenzentrum geholfen worden sei, ohne ihm beitreten zu wollen. Doch sicher ist: das nächste Jahr, in dem wieder Hinterbliebene Hilfe suchen werden, kommt bestimmt.
Weitere Informationen:
- Als zentraler Ort der Erinnerung und des Andenkens für Hinterbliebene nach Suizid wird am 10. September, dem Welttag der Suizidprävention, im Stadewäldchen (Märkische Straße / Ecke Saarlandstraße) in einer feierlichen Veranstaltung ein Ginkgobaum gepflanzt. Treffpunkt: um 17 Uhr, große Wiese.
- Das Krisenzentrum Dortmund arbeitet nach dem Grundsatz: Schnelle, niederschwellige und verlässliche Hilfe in Krisensituationen!
- Kontakt: Wellinghofer Straße 21, 44263 Dortmund
- Öffnungszeiten: montags bis freitags, 9.00 bis 13.00 Uhr und 14.00 bis 17:00 Uhr
- Tel.: 0231 / 435077; Fax: 0231 / 4270479
- Weitere Infos zum Krisenzentrum; hier:
- Freundes- und Förderkreis Krisenzentrum Dortmund e.V. – e-Mail: kontakt@foerderkreis-krisenzentrum.de; Tel.: 0231 / 435077; Homepage, hier:
- Spenden sind herzlich willkommen! Konto: Sparkasse Dortmund, IBAN: DE49 4405 0199 0321 0094 92, BIC: DORTDE33XXX
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:
Suizid-Prävention für junge Menschen: Projekt [U25] des SkF sucht junge ehrenamtliche HelferInnen
Suizid-Prävention für junge Menschen: Projekt [U25] des SkF sucht junge ehrenamtliche HelferInnen




Reaktionen
Schau nicht weg bei Suizid Anzeichen! Infos und Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige (PM)
Schau nicht weg bei Suizid Anzeichen! Infos und Hilfsangebote für Betroffene und Angehörige
Im Jahr 2018 sind in Deutschland insgesamt 9.396 Menschen durch einen Suizid verstorben, 1.402 dieser Menschen lebten in NRW. Obwohl sich die Statistik in den letzten zehn Jahren auf einem konstant hohen Niveau befindet, gehen Experten von einem deutlichen Anstieg in der aktuellen Pandemiezeit aus. Die USA meldeten hier erst vor kurzem alarmierend gestiegene Zahlen.
Suizid stellt dabei eine häufigere Todesursache dar, als alle Verkehrsunfälle, Morde und Drogen zusammen. Zudem ist es noch wichtig zu erwähnen, dass laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) jeder Suizid bis zu sechs weitere Personen, in der Regel Angehörige, betrifft. 70% der Menschen, die diese Todesform wählen, sind dabei Männer. Noch erschreckender ist in diesem Zusammenhang, die Zahl von ca. 100.000 jährlichen Suizidversuchen. Diese sollten unbedingt von den Angehörigen und weiteren Personen im Umfeld ernst genommen werden, denn ca. jeder dritte wird noch einen weiteren Versuch unternehmen und im Schnitt verstirbt jeder 10. Betroffene in der weiteren Folge.
„Die meisten Menschen die Suizide bzw. Suizidversuche begehen, äußern sich vorher! Zu achten ist dabei besonders auf eine erschwerte Lebenssituation, Trennung oder Verlust naher Menschen, Arbeitslosigkeit, Krankheit und Vereinsamung.“ so Steffi Linde aus dem Team der Partei Mensch Umwelt Tierschutz (Tierschutzpartei) in Dortmund und warnt zudem, dass die oft verwendete Aussage „Wer über Suizid redet, der macht es nicht“ eine komplett überholte und falsche Annahme sei. Linde, die sich sowohl beruflich als auch privat intensiv mit dem Thema beschäftigt hat, erwähnt als erste Anzeichen häufig einen Rückzug aus dem sozialen Umfeld wie Familie und Freunde, starke Stimmungsschwankungen, die intensive Auseinandersetzung mit dem Tod und oftmals ein leichtfertiges und/oder selbstzerstörerisches Verhalten z.B. beim Autofahren oder beim Konsum von Suchtmitteln.
Das Team der Tierschutzpartei appelliert, gerade in der aktuell schwierigen Zeit, an alle Bürger*innen, die Mitmenschen kennen, bei denen ein oder mehrere dieser Anzeichen zutreffen, diese unbedingt anzusprechen und ggf. eine entsprechende Hilfsorganisation zu kontaktieren. Des Weiteren ist Betroffenen ein schneller Zugang zu therapeutischer Hilfe mit geringen Wartezeiten zu ermöglichen, dies setzt aber einen deutlichen Ausbau der psychotherapeutischen Angebote und der zur Verfügung stehenden Therapieplätze voraus. Die Tatsache, dass Menschen oftmals bis zu einem Jahr und länger auf einen Therapieplatz warten müssen ist nicht haltbar und muss vordringlich angegangen werden.
Hilfsangebote:
Telefonseelsorge (24 Stunden) 0800/1110111 (ev.) 0800/1110222 (kath.)
zusätzlich bietet die Telefonseelsorge für Hilfesuchende einen Chat- und eine E-Mail-Beratung an. In allen Fällen ist das Angebot anonym und kostenlos
Ein muslimisches Angebot der Seelsorge ist 24 Stunden unter der 030/443509821 erreichbar.
Ärztlich/ psychologischer Bereitschaftsdienst: 116117- In absoluten Notfällen bitte direkt die 112 anrufen.
Weitere Beratungsstellen vor Ort (auch persönliche Gesprächsangebote) findet man unter Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention http://www.suizidprophylaxe.de oder bei der Deutschen Depressionshilfe http://www.deutsche-depressionshilfe.de