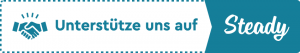Das kleine Fundstück ist ca. 4.500 Jahre alt. Zwei ehrenamtliche Bodendenkmalpfleger, S. Evers und R. Evers, fanden es vor einigen Wochen bei ihrer Suche auf einem Acker. Ihnen war bewusst, dass das gut erhaltene Objekt wohl aus der Steinzeit sein musste. Doch dass es sich dabei um eine sogenannte glockenbecherzeitliche Pfeilspitze handeln sollte, ahnte keiner der beiden. Ihr schöner Fund wurde nun von der Denkmalbehörde der Stadt Dortmund als Denkmal des Monats Mai ausgewählt.
Nadel im Heuhaufen: Vater und Sohn machen außergewöhnliche Entdeckung
Im Abstand von knapp einem Meter, die Köpfe gesenkt und die Blicke konzentriert auf die Erdoberfläche gerichtet, suchte das Gespann aus Vater und Sohn systematisch den unbestellten Acker im Dortmunder Süden in langen Bahnen ab. Eine mühevolle Arbeit, die sich jedoch an diesem Tag bezahlt machte. ___STEADY_PAYWALL___
Denn bei dem gerade einmal 1,55 Gramm schweren, nur 0,4 cm dicken und knapp 2,8 cm langen Fund handelt es sich um eine außergewöhnlich gut erhaltene Pfeilspitze aus Feuerstein (Silex). Dass sie das kleine Steinartefakt überhaupt entdeckt haben, ist großes Glück, unterscheidet es sich in seiner bräunlichen Farbe doch kaum vom dunklen Ackerboden. Ebenfalls bedarf es viel Erfahrung, um zwischen den zahlreichen, durch Pflug, Grubber und Egge „bearbeiteten“ Steinen, einen solchen, von Menschenhand gefertigten Gegenstand zu erkennen.
Bewährter Rohstoff von der Küste legte lange Reise ins Landesinnere zurück
Seit dem Paläolithikum, also seit der Altsteinzeit, verwendeten die Menschen Silex als Rohmaterial für Steinwerkzeuge und -waffen, wie beispielsweise Pfeilspitzen, Klingen, Schaber und Kratzer. Kennzeichnend für die knollenartigen Steine ist eine weiße Kruste (Cortex) und ihr scharfkantiger Bruch.
Farblich variieren sie von schwarz, grau über braun und grün bis rot, dabei ist der Stein durchscheinend. Das feinkörnige Sedimentgestein, dessen Entstehung rund 145 Millionen Jahre, also bis an die Wende von der Jura zur Kreidezeit zurückreicht, stammt keineswegs aus der Region. Vielmehr ist seine Verbreitung ins Landesinnere den skandinavischen Gletschern zuzuschreiben. Denn während der Drenthe Vereisung vor knapp 160.000 Jahren schoben die Eismassen die Steine von der Ost- und Nordseeküste auch in den Dortmunder Raum.
Fund stammt aus einer Zeit des tiefgreifenden Wandels in Europa
Die kleine Pfeilspitze ist dreieckig und mit zwei „Flügelchen“ sehr sorgfältig gefertigt. Lediglich ein Flügel ist leicht beschädigt. Die Blattflächen sind akribisch sanft bikonvex gearbeitet, auf einer Seite haben sich Reste des Cortex erhalten. Die Ränder weisen feine Retuschen auf. Sogar der Stiel zur Befestigung mit Birkenpech und Tiersehnen an einem Holzstab ist vorhanden.
Flügel und Stiel der Spitze enden in etwa auf gleicher Höhe. Pfeilspitzen dieses Typs stammen aus der Zeit zwischen 2600-2200 vor Christus und datieren damit an den Übergang von der Jungsteinzeit zur Bronzezeit. In diesen Jahrhunderten fand ein tiefgreifender Wandel in Europa statt.
Während die Menschen in Osteuropa durch Einwanderer aus den eurasischen Steppengebieten in deren Lebensstil und Kulturtechniken beeinflusst wurden, veränderten die sogenannten Glockenbecherleute von der iberischen Halbinsel das mittlere und westliche Europa. Namengebend waren ihre bauchigen, glockenartigen Gefäße, die sie mit sich führten.
Kultureller Austausch stieß wirtschaftliche Veränderungen an
Neben ihrer charakteristischen Tonware besaßen sie sowohl Steingeräte, u. a. die typischen geflügelten Pfeilspitzen, als auch schon Waffen und Schmuck aus Kupfer. Sie lebten vornehmlich von der Jagd und Viehzucht und galten als Spezialisten für den Abbau und die Weiterverarbeitung eines völlig neuen Werkstoffs, den Metallen insbesondere von Kupfer und Gold.
Offenbar erreichten die Fremden bei der einheimischen Bevölkerung hohes Ansehen, da auch sie begannen, deren Sitten, Bräuche und Techniken zu übernehmen. Vielleicht konnten sie auch von ihnen profitieren, denn mit den Möglichkeiten der neuen Technologien veränderte sich das seinerzeitige wirtschaftliche Gefüge Mitteleuropas grundlegend.
Mehr zum Thema bei nordstadtblogger.de:
Neoklassizistische Villa in Dorstfeld ist Denkmal des Monats