
Von Susanne Schulte
Als Isolde Parussel vor einigen Jahren die Leitung des Hoesch-Museums übernahm, wusste sie bereits, dass sie viel, viel Arbeit mit einem Ausstellungsstück haben würde, das nicht in die Regale des Archivs passt: Der geschenkte Stahlbungalow L141, von Hoesch in den 1960er als Fertighaus gebaut und der einzige dieser Form und Größe, sollte von Hombruch in die Nordstadt umziehen. Jetzt steht das Wohnhaus hinterm Museumsgebäude und ist zu besichtigen. Die Vollendung dieses Kraftakts wurde mit einem Festakt gefeiert und wird am kommenden Sonntag mit dem Tag der offenen Tür gewürdigt.
Geld und organisatorische Hilfe gab’s von vielen Seiten
Vertreter*innen diversen Stiftungen und Unternehmen sowie der Stadt und des Heimatministeriums waren eingeladen, im Gespräch mit Moderator Kay Bandermann ihre Motive für die zum Teil sehr großzügigen Geldgeschenke darzulegen. Landesministerin Ina Scharrenbach hatte kurzfristig abgesagt, doch es waren genug Gesprächspartner*innen vor Ort für zwei Rederunden.

Oberbürgermeister Thomas Westphal winkte verbal das Lob für seine Verwaltung ab: „Die Lorbeeren gehören allen Menschen, die das Museum führen. Wir waren nur hilfreich.“
Marcus von Marwick, bei ThyssenKrupp Steel Europe für die Kommunikation und die Nachhaltigkeit zuständig, erklärte, das Unternehmen wolle die Geschichte pflegen, und Dr. Karl Lauschke, Vorsitzender des Täger- und Fördervereins Hoesch-Museum, lobt beide Vorredner: „Stadt und ThyssenKrupp haben uns massiv unterstützt.“ Vor allem sei es eine „Mammutaufgabe für Isolde Parussel“ gewesen.
Stiftungen ließen sich nicht lumpen – Genaue Summen wurden nicht genannt
Kirsten Bernhardt vom Museumsamt des LWL begründete die Förderung des Landschaftsverbandes damit, dass es sich um ein Großprojekt handele, dass Räume für Veranstaltungen entstanden seien und das Haus die Industriegeschichte dokumentiere.

Für Professorin Dr. Dr. h.c. Ursula Gather, Vorsitzende des Kuratoriums der Krupp-Stiftung, ist der Bungalow ein kulturelles Erbe und zeigt auch Architekturgeschichte auf, und für Dirk Schaufelberger, Vorstandsvorsitzender der Dortmunder Sparkasse, ist es die soziale Verantwortung, die das Geldinstitut das Vorhaben unterstützen ließ.
Zwar wurde viel über die finanzielle Hilfe geredet, aber Zahlen, wie teuer denn der Umzug des Hauses nun war, hörten die mehr als 100 Gäste nicht. Auf eine entsprechende Frage von Nordstadtblogger am Rande der Veranstaltung antwortet Isolde Parussel: „Mehr als eine Million. Aber wir haben selbst das Geld nicht in Händen gehabt.“ Deshalb könne sie keine genaue Summe nennen.
Die Geschichte der Fertighäuser ist mehrere Jahrhunderte alt
Den Festakt schloss der Vortrag von Professorin Dr. Barbara Schock-Werner von der Nordrhein-Westfalen Stiftung Naturschutz, Heimat- und Kulturpflege über die Geschichte von Fertighäusern ab. Das Publikum erfuhr, dass Leonardo da Vinci als Erfinder dieser Konstruktion gilt und Zelte, Bau- und Zirkuswagen die einfachsten Produkte der Bauweise sind.

Ende des 19. Jahrhunderts entstanden sogenannte Wolgasthäuser der Bäderarchitektur. Walter Gropius und Konrad Wachsmann waren ebenfalls von der Idee begeistert, Häuser im Baukastensystem zusammen zu setzen. Das Einsteinhaus in Caputh steht noch heute.
Auch in den USA entwickelten beide in den 1940er Jahren diese Linie weiter und gingen mit dem Packaged House System auf den Markt. Neben Holz wurde Stahl als Baustoff genutzt, später auch Aluminium für das Modell Dymxion, in denen die US-Armee ihre Offiziere unterbrachte. „Ein Haus kostete soviel wie ein Auto.“
Wohnen im Stahlbungalow: Leichtes Putzen, aber kein prima Klima
In Deutschland konnte man nach dem Zweiten Weltkrieg Fertighäuser aus dem Katalog bei Neckermann und Quelle kaufen. MAN versuchte sich im Stahlhausbau und auch die Firma Hoesch. 1964 errichtete das Dortmunder Unternehmen in Hombruch die Werkssiedlung Kleinholthausen, darunter sechs Stahlbungalows für die Familien von Führungskräften.
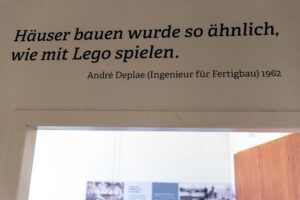
Eines war der Typ L141. Das L stand für die Form, die 141 für die Quadratmeterzahl. Als die ersten Bewohner*innen 1977 dort auszogen, siedelte Hans-Hubert Hoff mit Frau und fünf Kindern aus einem kleineren Haus der Siedlung in das größere über. Jahre später kaufte er das Haus und nach seinem Tod schenkten seine Kinder das Haus dem Museum.
Den Kontakt stellte Dr. Silke Haps her, die sich wissenschaftlich mit dem Werkstoff Platal beschäftigte, aus dem Wände, Decken und Türen des L141 bestehen. Dieses mit PVC beschichtete Stahlblech ist zwar pflegeleicht, hat aber auch Nachteile.
Die Kinder des letzten L141-Bewohners reisten zur Feier an
Welche das sind, ist in Zitaten an den Wänden des Hauses zu lesen. So soll sich das Material bei Kälte derart zusammenziehen, dass es kracht, und bei Hitze blieben die Bewohner*innen von Stahlbungalows oft sehr lange vor der Tür, bis es sich drinnen abgekühlt hatte. Was die Kinder des Ehepaares Hoffs noch so zu erzählen wussten, taten sie am Dienstag nach Ende des Festaktes wohl in persönlichen Gesprächen, aber nicht auf der Bühne. Alle fünf waren angereist, Karin Östreicher sogar aus London.

Aber auch ohne die Zeitzeug*innen lohnt ein Rundgang durchs Haus. Die Wände sind einheitlich cremefarben, konnten aber auch mit anderen Lackierungen bestellt werden wie für Küche oder Bad. Nägel fanden keinen Weg durch den beschichteten Stahl.
Wer Bilder aufhängen wollte, musste eine spezielle Leiste unter der Decke anbringen. Dafür war nie ein neuer Anstrich nötig – weder innen, noch außen. In der Küche hängt eine Informationstafel, dass die Familie Hoff alle paar Jahre Wände, Türen und Decken gründlich abschrubbte, aber ohne Scheuermittel, das schädigt die Beschichtung. Kleine Kratzer wurden mit einem Lackstift ausgebessert.
Tag der offenen Tür beginnt am Sonntag um 10 Uhr
Das alles lesen die Besucher*innen am Tag der offenen Tür am kommenden Sonntag, 11. Mai, beim Rundgang durchs Haus. Das Programm, mit dem auch das sanierte Museum wieder öffnet, beginnt um 11 Uhr mit der Begrüßung, Einlass ist bereits um 10 Uhr.

Um 12.30 Uhr bittet Isolde Parussel Zeitzeug*innen zum Gespräch übers Wohnen im Stahlhaus auf die Bühne, und von 12 bis 16 Uhr können sich die Gäste Kurzführungen anschließen und Filme zum Wohnen in Stahlhäusern ansehen. Zudem ist die Sonderausstellung „Wir machen blau! Cyanotypie-Kunstwerke von Jugendlichen“ aufgebaut.
Das Hoesch-Museum an der Eberhardstraße 12 in Dortmund ist mit der U44, Endstelle Westfalenhütte, gut zu erreichen. Wer mit dem Auto kommt, findet einen großen Parkplatz in Museumsnähe vor.
Anm.d.Red.: Haben Sie bis zum Ende gelesen? Nur zur Info: Die Nordstadtblogger arbeiten ehrenamtlich. Wir machen das gern, aber wir freuen uns auch über Unterstützung!
Mehr auf dazu auf Nordstadtblogger:
Stahlbungalow reist in der Nacht quer durch die Stadt an den neuen Standort am Hoesch-Museum
Der Umzug des Stahl-Bungalows von Hombruch zum Hoesch-Museum auf die Westfalenhütte steht
Das Stahlhaus am Hoesch-Museum könnte Realität werden, wenn die Finanzierung klappt






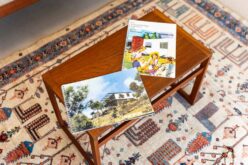




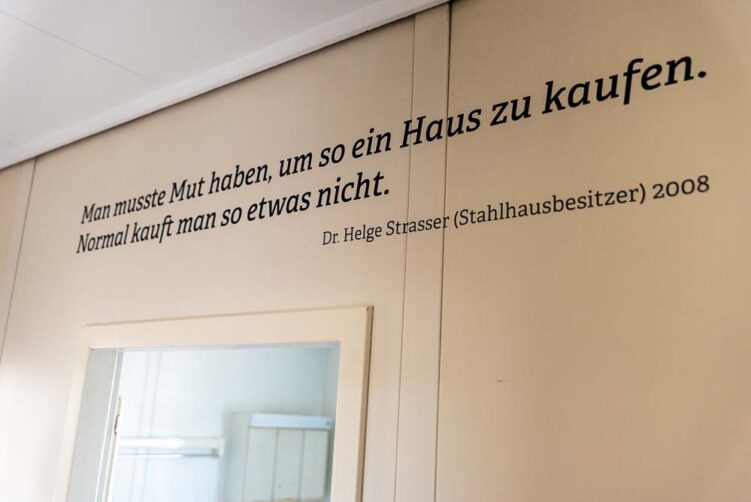



Reaktionen
Zwei neue Ausstellungen und ein Stahlhaus locken in die Museen (PM)
Am Sonntag bieten die Museen in Dortmund viel Besonderes: Gleich zwei neue Ausstellungen, zum Beispiel Kunst rund ums Essen, einen Tag der offenen Tür um ein neues Stahlhaus im Hoesch-Museum und Kreatives zum Mitmachen.
Essen und Kunst, Basteln, viele Aktionen rund um den neuen Stahlbungalow mit viel 1970er-Flair – da fällt die Entscheidung am Sonntag besonders schwer. Aber vielleicht passen auch gleich mehrere Termine in den Ausflugplan in Sachen Kultur?
Tag der Offenen Tür im Hoesch-Museum
Von 10 bis 17 Uhr öffnet das Hoesch-Museum, Eberhardstr. 1, seine Türen zum ersten Mal nach den Sanierungsarbeiten wieder. Zu sehen ist dann auch die neue Attraktion, der Stahlbungalow, mit einer neuen Ausstellung über das Werkswohnen in den 70ern, die Entwicklung der Bauteile und des besonderen Stahls der Firma Hoesch sowie über die Geschichte der Stahlhäuser der Moderne. Es gibt den ganzen Tag über Programm wie Zeitzeug*innen-Gespräche zum Wohnen in einem Stahlhaus, Kurzführungen durch das Stahlhaus und das Hoesch-Museum, Filmvorführung zu Wohnen, Stahlhäusern und die Eröffnung der Sonderausstellung: „Wir machen blau! Cyanotypie-Kunstwerke von Jugendlichen“.
Ausstellung von Ingo Schultze-Schnabl im Torhaus Rombergpark
Im Torhaus Rombergpark eröffnet am Sonntag um 11 Uhr die Ausstellung von Ingo Schultze-Schnabl „Sieht man doch!“ Ingo Schultze-Schnabl geht der Frage nach unserem Sehen mit künstlerischen Mitteln nach und aktiviert unsere Wahrnehmung auf seine spezielle Art und Weise. Ingo Schultze-Schnabl thematisiert in lebhaften und oft leuchtenden Gemälden, wie unsere Wahrnehmung aus Teilinformationen ein Ganzes konstruiert. Seine Bildsprache, Gemälde auf mehreren Bildtafeln mit Abstand zu verteilen, macht bewusst, wie unser Kopf ständig Zusammenhänge schafft und Sinn deutet. dortmund.de/kulturbuero-galerie-torhaus
„Am Tisch“ zeigt Kunst und Kulinarik
Um 13:30 Uhr startet eine Führung durch die neue Ausstellung auf der Ebene 6 des Dortmunder U: Die Sonderausstellung „Am Tisch“ des Museum Ostwall im Dortmunder U (MO) zeigt Arbeiten zeitgenössischer Künstler*innen, die gemeinschaftliche Aspekte der gemeinsamen Mahlzeit in den Blick nehmen. Mit Essen und Trinken verbinden wir Traditionen, Regeln und Rituale, die Menschen zusammenbringen, aber auch ausschließen können. Eintrittspreise: 5 Euro regulär, 3 Euro ermäßigt. dortmunder-u.de/museum-ostwall
Sammlungspräsentation „Kunst – Leben – Kunst“
Im Museum Ostwall im Dortmunder U findet außerdem um 15 Uhr eine kostenlose Führung durch die Sammlungspräsentation statt. Die Präsentation „Kunst – Leben- Kunst. Das Museum Ostwall gestern, heute, morgen“ zeigt anhand einer Auswahl von Werken der MO_Sammlung von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart, wie Gründungsdirektorin Leonie Reygers das Alltagsleben in der Region Dortmund gestalten wollte. Außerdem vermittelt sie, wie sich die Künstler*innen der MO_Fluxus-Sammlung vom Alltagsleben inspirieren ließen, welche Rolle Autodidakt*innen und Kunstlaien dabei spielten und wie gesellschaftliche Debatten die MO_Sammlungspolitik von den 1950er-Jahren bis heute prägen. dortmunder-u.de/museum-ostwall
Black Comics: Vom Kolonialismus zum Black Panther
Wie sich Schwarze Figuren im Comic vom Kolonialismus bis zur modernen Selbstbestimmung entwickelten, zeigt die Ausstellung „Black Comics – Vom Kolonialismus zum Black Panther“ im schauraum: comic + cartoon, Max-von-der-Grün-Platz 7. Um 13 Uhr beginnt eine öffentliche Führung, die Themen wie Kolonialismus, Alltagsrassismus und die kreative Freiheit Schwarzer Künstler*innen beleuchtet. Der Eintritt kostet 3 Euro. dortmund.de/comic
Offene Kreativwerkstatt im MKK
Das Museum für Kunst und Kulturgeschichte (MKK), Hansastraße 3, lädt am Sonntag von 14 bis 17 Uhr zur offenen Kreativwerkstatt ein. Jugendliche und Erwachsene haben hier die Möglichkeit, frei zu experimentieren. Die Teilnahme beträgt 5 Euro pro Person. dortmund.de/mkk
Familiennachmittag im Kindermuseum
Das Kindermuseum Adlerturm (Günter-Samtlebe-Platz 2) lädt zum Familiennachmittag: Kinder und ihre Familien reisen zurück in die Zeit des Mittelalters. Zwischen 14:30 und 16:30 Uhr können die Kinder basteln und passende Geschichten aus der Vergangenheit hören. Der Familiennachmittag ist kostenfrei. dortmund.de/adlerturm
Führung zur traditionsreichen Bierstadt
Um 15 Uhr lädt das Brauerei-Museum (Steigerstr. 16) zu einer spannenden Führung ein, die innerhalb von 90 Minuten Eindrücke von der Blütezeit der Bierstadt Dortmund seit den 1950er-Jahren vermittelt. Führung 4,50 Euro pro Person, Eintritt frei. Anmeldung erwünscht: brauereimuseum-dortmund@radeberger-gruppe.de. dortmund.de/brauereimuseum
Kultur von der Ritterrüstung bis zum Stahlhaus, vom Bier zur Installation aus Halva entdecken (PM)
Wohin am Ausflugs-Sonntag? Die Museen bieten interessante Führungen zur Biertradition, zum Thema Kunst und Kulinarik und Historisches von der Ritterrüstung bis zum Stahlhaus. Ein buntes Programm mit Führungen in den Museen und im Dortmunder Stadtraum gibt es am Sonntag in Dortmund.
Hoesch-Museum: Tour durchs Museum
Die Spuren von Stahl und Eisen in Dortmund können Interessierte im Hoesch-Museums entdecken. Dazu startet um 14 Uhr eine Führung durch die Dauerausstellung. Zu sehen ist auf dem Gelände auch die neue Attraktion, der Stahlbungalow, mit einer neuen Ausstellung über das Werkswohnen in den 70ern, die Entwicklung der Bauteile und des besonderen Stahls der Firma Hoesch sowie über die Geschichte der Stahlhäuser der Moderne. dortmund.de/brauereimuseum
Von Export, Pils und alten Bier-Traditionen
Im Brauerei-Museum Dortmund startet um 15 Uhr eine 90-minütige Führung, die in die Blütezeit der Bierstadt Dortmund eintauchen lässt. Besucher*innen erfahren, wie Dortmund zur Hochburg der Braukunst wurde und erhalten spannende Einblicke in die Geschichte des Bierbrauens. Die Führung kostet 4,50 Euro, der Eintritt ins Museum ist frei. Anmeldungen sind per E-Mail an brauereimuseum-dortmund@radeberger-gruppe.de möglich. dortmund.de/brauereimuseum
Stadtspaziergang: Spuren der Gründerzeit in der Nordstadt
Um 14:30 Uhr geht es zur Erkundungstour in die Dortmunder Nordstadt – dort befindet sich das flächenmäßig größte zusammenhängende Gründerzeitviertel in NRW. Die Führung konzentriert sich vor allem auf die Fassaden privater Wohnhäuser. Zu sehen gibt es aber auch Objekte, die von Handel und Gewerbe zeugen sowie – von außen – das imposante, schlossähnliche Gebäude des heutigen Helmholtz-Gymnasiums. Karten bitte vorher im Museum für Kunst und Kulturgeschichte kaufen: 8,90 Euro (ermäßigt 4,50 Euro). Treffpunkt: Restaurant Nansen, Speicherstraße 15. dortmund.de/mkk
Essen und Trinken im Museum
Um 13:30 Uhr startet eine Führung durch die kulinarische Ausstellung „Am Tisch“. Die Sonderausstellung des Museum Ostwall im Dortmunder U (MO) auf der Ebene 6 des Dortmunder U zeigt Arbeiten zeitgenössischer Künstler*innen, die gemeinschaftliche Aspekte der gemeinsamen Mahlzeit in den Blick nehmen. Mit Essen und Trinken werden Traditionen, Regeln und Rituale verbunden, die Menschen zusammenbringen, aber auch ausschließen können. Eintrittspreise: 5 Euro regulär, 3 Euro ermäßigt. Mit Eintrittskarte ist die Führung kostenfrei, Treffpunkt am Eingang der Ausstellung, Ebene 6.
Interessantes aus der Sammlung im MO
Um 15 Uhr startet eine Führung durch die Sammlungssräsentation im Eingangsbereich der Ebene 5. „Kunst – Leben – Kunst. Das Museum Ostwall gestern, heute, morgen“ zeigt anhand einer Auswahl von Werken der MO_Sammlung Arbeiten von der klassischen Moderne bis zur Gegenwart. Außerdem vermittelt sie, wie sich die Künstler*innen vom Alltagsleben inspirieren ließen und welche Rolle Autodidakt*innen und Kunstlaien dabei spielten. dortmunder-u.de/museum-ostwall
Auf Zeitreise im Adlerturm: Das Mittelalter entdecken
Von 14 bis 15:15 Uhr geht es bei einer Familienführung durch alle sechs Etagen des historischen Adlerturms. Teilnehmende entdecken spannende Details zum mittelalterlichen Dortmund und begegnen berühmten Dortmunder Persönlichkeiten. Diese Reise durch die Stadtgeschichte ist für Kinder ab 6 Jahren geeignet und kostet 3 Euro pro Person. dortmund.de/adlerturm
Hoesch-Museum zeigt neue Ausstellung zum Karlsquartier und lädt zur Diskussion über Migration im Ruhrgebiet (PM)
Das Hoesch-Museum Dortmund eröffnet am Sonntag, 15. Juni 2025, um 11 Uhr die Sonderausstellung „Karlsquartier: Zweiter Architekturwettbewerb für den neuen Norden“ im neuen Ausstellungsgebäude Hoesch-Stahlhaus L141. Gezeigt werden die Ergebnisse des jüngsten Architekturwettbewerbs zum zweiten Baufeld des Karlsquartiers, einem großen Wohnbauprojekt nördlich des Borsigplatzes, das gemeinsam mit der BPD Immobilienentwicklung GmbH realisiert wird.
Aus dem Wettbewerb ging der Entwurf von florian krieger, architektur und städtebau als Sieger hervor. Die Jury lobte insbesondere die stimmige Verbindung der baulichen Vorgaben mit einem Konzept, das auf nachbarschaftliches Wohnen setzt. Die Ausstellung ist bis zum 27. Juli 2025 zu sehen.
Am Montag, 23. Juni 2025, widmet sich das Hoesch-Museum in Kooperation mit dem DIFIS der Universität Duisburg-Essen und der FH Dortmund der Migrationsgeschichte des Ruhrgebiets. Unter dem Titel „Zwischen Prekarität und Aufstiegsversprechen?“ werden von 12 bis 18 Uhr Arbeits- und Lebensbedingungen von Migrant*innen – damals und heute beleuchtet. Die Veranstaltung bringt wissenschaftliche Perspektiven mit Zeitzeug*innenberichten zusammen und bietet Raum für Diskussion und Austausch. Die Teilnahme ist kostenlos, aber nur nach Anmeldung bis zum 18. Juni möglich (E-Mail: cruesberg@stadtdo.de).
Abgerundet wird das Programm am selben Tag um 16:30 Uhr mit einer Lesung der Journalistin und Autorin Gün Tank aus ihrem Buch „Die Optimistinnen“. Die Autorin erzählt darin von den oft überhörten Geschichten der ersten Generation von Arbeitsmigrantinnen. Der Eintritt zur Lesung ist frei, eine Teilnahme an der vorherigen Veranstaltung ist nicht erforderlich.
Alle Programmpunkte finden im Hoesch-Museum statt und sind kostenfrei zugänglich.
NRW-Stiftung auf Hausbesuch am Hoesch-Museum: Stahlhaus L141 Thema in neuer Podcastfolge (PM)
Düsseldorf/Dortmund: Mit seinen 141 Quadratmetern ist das Stahlhaus L141 das größte Ausstellungsstück des Dortmunder Hoesch-Museums. Seit Mitte Mai erweitert das ehemalige Wohnhaus aus dem Jahr 1964 das Museumskonzept.
Damit der Bungalow aus Stahl aber seinen Platz auf dem Gelände der ehemaligen Westfalenhütte einnehmen konnte, war ein aufwendiger Umzug nötig. Als überbreiter Schwertransport wurde das Haus im November 2022 in zwei Teilen von seinem alten Standort in Kleinholthausen auf zwei Lkw versetzt. Die NRW-Stiftung hat die Translozierung mit einer Förderung von bis zu 250.000 Euro unterstützt. Kennenlernen kann man das besondere Ausstellungsstück nun in der neuesten Folge des Podcasts „Förderbande“.
In ihrem Podcast fördert die NRW-Stiftung jeden Monat kleine wie große, wohlbekannte wie bisher verborgene Schätze zu Tage, die es überall in Nordrhein-Westfalen zu entdecken gibt. Gemeinsam mit wechselnden Gästen geben die Journalistinnen Marija Bakker und Cornelia Wegerhoff Einblicke in die Arbeit der NRW-Stiftung und werfen einen Blick hinter die Kulissen ihrer Förderprojekte. In der neuesten Episode nimmt Cornelia Wegerhoff Hörerinnen und Hörer mit auf einen Hausbesuch ins Stahlhaus L141.
Das Fertighaus wurde vom Konzern Hoesch entwickelt und aus dem Verbundwerkstoff Platal gefertigt. Durch sein Material und Baukonzept ist der Bungalow ein Zeugnis innovativer Baukunst der 1960er Jahre. Im L141 lebte ab 1977 die siebenköpfige Familie Hoff. Nach dem Tod des letzten Bewohners 2012 schenkte die Familie das Haus dem Hoesch-Museum.
Gemeinsam mit der Museumsleiterin Isolde Parussel und Wolfgang Weick vom Verein „Freunde des Hoesch-Museums“ wirft Cornelia Wegerhoff einen Blick ins Innere des Hauses. Zwischen Wohnzimmer und Gäste-Bad wird hier Industrie- und Architekturgeschichte erlebbar. Und auch die ehemaligen Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses kommen zu Wort: Die Familie Hoff berichtet, wie es sich in einem Haus aus Stahl gelebt hat und ob man wirklich keinen Nagel in die Wand bekommen hat.
Eine neue Folge der „Förderbande“ erscheint an jedem zweiten Donnerstag im Monat. Der Podcast ist überall zu finden, wo es Podcasts gibt, und natürlich auf der Internetseite der NRW-Stiftung: https://www.nrw-stiftung.de/podcast.
Die Nordrhein-Westfalen-Stiftung konnte seit ihrer Gründung 1986 mehr als 3.800 Natur- und Kulturprojekte mit insgesamt über 325 Millionen Euro fördern. Das Geld dafür erhält sie vom Land NRW aus Lotterieerträgen von Westlotto, aus Mitgliedsbeiträgen ihres Fördervereins und Spenden. Mehr Informationen auf http://www.nrw-stiftung.de und im Podcast „Förderbande“.
Das Hoesch Stahlhaus bleibt in der nächsten Woche bis Mittwoch geschlossen – die Arbeiten für die Gestaltung des neuen Gartens am Bungalow beginnen jetzt (PM)
Das Hoesch-Stahlhaus auf dem Gelände des Hoesch-Museums bleibt in der nächsten Woche von Montag bis einschließlich Mittwoch (4. bis 6. August) geschlossen. Der Grund sind Bauarbeiten zwischen den beiden Museumsgebäuden.
In der nächsten Woche starten die vorbereitenden Arbeiten für den neuen Garten des Stahlbungalows. Das Hoesch-Stahlhaus L141 von 1966 steht seit Mai auf dem Museumsgelände im Dortmunder Norden zur Besichtigung bereit und zeigt eine neue Ausstellung über das Werkswohnen, die Forschungsarbeit der Firma Hoesch und über die Geschichte der Stahlhäuser der Moderne. Die Terrasse bietet einen Blick auf das Hauptgebäude des Hoesch-Museums sowie das neu entstehende Karlsquartier und den Grünen Ring als neuen Park. Im Zuge der Arbeiten für den Grünen Ring bekommt auch der Stahlbungalow einen eigenen Museumsgarten.
Hintergrund: Der „Grüne Ring“ bietet Erholung und neue Wege
Der Grüne Ring wird das gesamte Gelände der ehemaligen Westfalenhütte umschließen. Es entsteht ein neuer öffentlicher Park, der zur Naherholung und Freizeitgestaltung einlädt und auch die Belange des Naturschutzes berücksichtigt. Vor allem für die Menschen in der dicht bebauten Nordstadt soll er zum vielfältigen Ort der Begegnung im öffentlichen Raum werden. Mit den geplanten Rad- und Fußwegen bietet der Grüne Ring auch den Menschen in Eving, Kirchderne und Scharnhorst neue Wegeverbindungen. Der Bau des ersten Teilbereichs vom Grünen Ring beginnt nach den Vorarbeiten am Hoeschmuseum im August. Die Bauarbeiten für den gesamten Park werden voraussichtlich vier bis fünf Jahre dauern.
dortmund.de/hoeschmuseum
Mehr Informationen zum Grünen Ring gibt es unter dortmund.de/gruenerring.
Museumsgespräch: Der Weg vom innovativen Stahlhaus zum Museumsstück – Gespräch im Hoesch-Museum über die Gestaltung des Hoesch-Stahlhauses L141
Seit Mai können Besucher*innen das Hoesch-Stahlhaus L141 von 1966 besichtigen. Wie aus einem innovativen Stahlbungalow ein Museumsstück wurde, erzählt Maya Porat-Stolte am Donnerstag, 14. August, ab 18 Uhr im Wohnzimmer des Hauses am Hoesch-Museum.
Maya Porat-Stolte hat während der vergangenen Jahre die Versetzung des Hauses auf das Museumsgelände und die Ausarbeitung der Ausstellung wissenschaftlich begleitet und gibt Einblicke in das Gestaltungskonzept und die Einrichtung der neuen Museumsräume. Dabei ist das Haus auch selbst ein Museumsstück. Neben den Ausstellungsräumen sind das Badezimmer und die Küche teilweise im Originalzustand erhalten. In den Räumen sind kleine Inszenierungen des Alltagslebens der 1970er-Jahre zu entdecken.
Innovative Baukunst und industrielles Wohnen
Das historische Wohnhaus aus der Werkssiedlung Kleinholthausen ist ein einzigartiges Zeugnis innovativer Baukunst der 1960er-Jahre. Entwickelt vom Dortmunder Montankonzern Hoesch, wurde es aus dem Verbundwerkstoff Platal gefertigt. Heute zeigt in einer kulturhistorischen Dauerausstellung die Geschichte industriellen Wohnens, die Entwicklung von Fertig- und Stahlhäusern sowie die Rolle von Stahl in Architektur und Bauwesen.
Der Vortrag findet im Wohnzimmer des Stahlhauses statt. Das Gebäude selbst ist wegen der Veranstaltung bis 18 Uhr zu besichtigen (reguläre Öffnungszeit donnerstags 9 bis 17 Uhr). Der Eintritt ist frei.