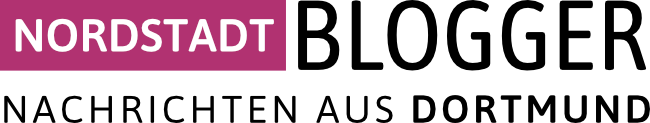Ein Gastbeitrag von Frederik Schreiber („Schlakks“)
freischaffender Künstler, (Mit-) Clubbetreiber und Dozent
Seit einem Jahr ist die Kultur nahezu vollständig gelähmt. Es geht ja auch irgendwie, sagen einige. Aber eigentlich geht hier gar nichts mehr. Wir müssen wieder strahlen.
Das hier ist kein Plädoyer für die schnelle Öffnung von Kulturstätten (schwierig) und auch keine Kritik an den Öffnungskonzepten der Länder (jaja: mitunter absurd). Das ist noch nicht mal ein Verriss der Hilfen für die Kultur (klar, könnte so viel besser sein) und hier folgt auch keine eklatante Besprechung von Systemrelevanzen (was für ein Wort). Und um Himmels Willen: Es geht nicht ums Jammern. Hier ist ja immer noch irgendwie alles voller Privilegien.

Aber es gibt keinen Grund, hier jetzt alles auf einmal okay zu finden. Ich meine, was für ein Leben leben wir hier gerade? Als Künstler, der seine Kraft aus den Tiefen der menschlichen Begegnung saugt, ist hier für mich eigentlich fast alles nicht mehr da. Es ist doch klar, dass wir an dieser gespenstischen Abwesenheit jedweder Kultur zu Grunde zu gehen.
Wenn der größte Batzen Kultur, den wir gerade finden, die Begegnung an der Supermarktkasse ist, ist das nicht okay. Es gibt auch keinen Grund dazu, sich die Abwesenheit all dessen, worauf wir als Kulturschaffende unseren Lebensentwurf aufgebaut haben, als Lappalie zu bezeichnen. Es geht um so viel mehr als ein bisschen Halligalli (wobei ich Halligalli liebe). Für viele von uns geht es um fast alles.
Wir haben das doch nicht alles jahrelang gemacht und dafür mit aufgerissenen Augen ein einigermaßen abwegiges Leben entworfen, um uns jetzt den Verlust dessen schön zu schwafeln. Wir haben verloren, was uns ausmacht. Begegnung ist nahezu ausgestorben, von Intensität erst gar nicht zu sprechen. Und all diese Entschleunigung: das Bücherlesen und die poetisierte und angekitschte Schönheit der Zurückgezogenheit. Das ist alles großartig – aber das war es immer schon. Muss erst eine Pandemie kommen, damit wir es schaffen, ein gutes Buch zu lesen? Du meine Güte.
Langeweile ist für mich eigentlich nur ein vager Begriff. Ich kenne sie kaum. Auch das Alleinsein ist kein Problem – gerade als Künstler ist sie oft das Herzstück der Arbeit. Gewaltige Reflexion kann unglaubliche Werke spucken. Und sowieso: Nach drei Tagen hintereinander in Clubs liebe ich es, einige Tage lang kaum Menschen zu sehen. Das Alleinsein war für mich immer die Harmonisierung der Überforderung, der aufatmende Ausgleich zur unverschämten Clubnacht. Nur: Jetzt gibt es kaum noch etwas auszugleichen. Und was braucht es Entschleunigung ohne die gute Reizverwüstung.
Dieses ganze Ding war natürlich auch immer die Idee, sich herauszuschälen aus gesellschaftlichen Rhythmen. Weg von 9to5 und all dem, was wir niemals wollten. Was eitel klingen mag, hatte auch immer die Idee, einen eigenen Lebensentwurf zu finden in einer Gesellschaft, in der einem viele Dinge zuwider sind. Und so auch die Option zu haben, diese Gesellschaft des Spektakels misstrauisch und zumindest teilweise von außen zu betrachten. Sich nicht mit der Tristesse des verbürgerten und beschränkenden Alltagstrotts zu begnügen, kann tönend daherkommen, ist aber mitunter ein properes Mittel der Subversion. Die zwangsweise Anpassung ist zum Kotzen.

Jede meiner bisherigen Platten ist die Schilderung und Beleuchtung von Dingen, die es gerade nicht gibt. Wenn ich meine Texte runter breche, geht es eigentlich fast immer nur um Begegnung. Um unverhoffte Erlebnisse auf dem Bordstein, im Club oder im Nachtzug. Um Kultur. Selbst wenn ich Naturbilder erzähle, rede ich eigentlich über Menschen. Die Menschen kommen zuerst. Erst danach und daraus kommt die Musik.
Das ist bei vielen Musiker:innen natürlich anders – ich habe Freund:innen, die sind vollkommen begnügt damit, ein Jahr lang zu Hause alleine Musik zu machen. Aber bei vielen von uns Texter:innen, die lyrisch mitten im Urbanen rumhängen – an der Ader des kulturellen Erlebens und des aufgedrängten Widerspruchs – sieht die Sache anders aus. Fast alles, worüber und wofür wir geschrieben haben, ist nicht mehr erlebbar.
Das ist natürlich in erster Linie unser eigenes profanes Problem, aber wenn all diese Welten, die da so besessen besungen werden, nicht mehr sind, dann ist offenbar etwas Größeres verschwunden. Es ist wenig verwunderlich, dass ich mich dieser Tage in den Worten anderer Begegnungsfreaks wie Thees Uhlmann, Danger Dan, Schorsch Kamerun oder Azudemsk wieder finde.
Und davon ab: Es ging niemals nur ums Texten. Vor allem wollte ich auf Tour gehen. Aber nehmen wir uns mal nicht zu ernst ‚da oben‘ auf der Bühne. Es geht ja auch nie nur ums Konzert. Es ist das ganze Faszinosum, was sich drumherum ausbreitet. Ich bin selbst als Zuschauer für Konzerte durch halb Europa gefahren. Und die Geschichten von all dem, was vor und nach der Show passiert ist, waren meist noch besser als die Show selbst. Das spricht noch nicht mal gegen das Konzert. Im Gegenteil. Die kitzelnde Schönheit des unverhofften Zufalls ist ein großer Schatz – durch kulturelles Erlebbarmachen wird er aufgespürt. Aber all das ist jetzt weg. Seit einem Jahr bin ich nicht mehr überrascht.
Und natürlich gibt es von Künstlerseite wenig Bezaubernderes, als sich restberauscht vom Konzert des Vortags und den verworrenen Gesprächen danach in einem undurchsichtigen Dunst aus Endorphinen und genialer Erschöpfung zu fragen, was da später auf eine:n zukommt. Was für Leute dir da gleich die Tür aufmachen. Ich kenne das als Künstler einerseits und als Mitbetreiber eines Clubs andererseits von beiden Seiten.
Es geht nicht nur um die Kunst auf der Bühne. Clubs sind Kulturen. Welten. Weil all diese Clubs ja auch oft noch so dermaßene Utopien sind, mit diesen Leuten, Menschen, die gemeingesellschaftlich vielleicht als Freaks gelten, die sich teilweise seit Jahrzehnten für ihre Träume die Wochenenden um die Ohren schlagen. An diesen Orten, an denen alles ein bisschen anders läuft. Heterotopien. Eigensinnige, ja andere Orte voller aufhebelnder Ideen und Sehnsüchte. Diese Orte existieren gerade nicht mehr. Und was ist jetzt mit dieser Sehnsucht und den Ideen – wo sind die abgeblieben?
Im digitalen Zeitalter? Ich bitte dich.

Die Kunstwelt steht ja immer auf der Kippe: Einerseits werden hier avantgardistisch neue Diskurse und Bewegungen aufgebrochen. Hier entstehen Sichtweisen, die Gesellschaft formen und umwälzen können. Andererseits ist die Kunst leider auch ein Sammelbecken für exzessiven Narzissmus, der mich mitunter so reizt, dass ich manchmal die Lust an allem verliere. Die Verlagerung ins Digitale tut dem wenig gut.
Es ist ja fast schon obsolet sich über die Enddärme von Instagram und Facebook zu echauffieren, zumal diese Kanäle gerade zumindest ein Weg der Mitteilung in isolierten Zeiten sind. Und natürlich gibt es hier Möglichkeiten. Aber diese Hyperwelt ist nun mal primär zur Aufmöbelung des eigenen Ichs gebaut und nicht für die Begegnung und die sensible Verbindung – und auch nicht für die Momente davor und danach.
Und auch deswegen fehlen all die kulturellen Off-Orte, die Kulturschaffende zusammenbringen. Übers Backstage wurde schon viel geschrieben seit der Erfindung des Rock ‘n‘ Roll. Einerseits gibt es da all die popkulturellen Aufladungen mit ihren mythisierenden Anekdoten über Exzesse und Sternchen und andererseits ist da die Behauptung, Backstage sei der langweiligste Ort der Welt. Irgendwas dazwischen stimmt wahrscheinlich. Meist ist es dann doch schon ziemlich aufreibend, wenn ein paar Angeheizte oder Abgeregte vor und besonders nach dem Abliefern ihr Restadrenalin gemeinsam verschütten. Klar stinkt es auch hier oft übel nach Ego. Aber aus diesen Abenden entstehen nicht nur populäre Geschichten, sondern auch die allerersten Momente für so vieles, was wir ein paar Monate später auf der Bühne sehen.
Das ist alles nicht mehr da.
Natürlich müssen wir da jetzt noch durch. Und das ist, natürlich, völlig richtig so. Doch dieser Zustand hier ist miserabel. Wenn hier gerade Leute kaputt gehen, dann ist das nicht nur legitim, sondern auch innigst menschlich. Und ich will übrigens auch nicht in einer Gesellschaft leben, in der man nicht mehr feiert. Da verzichte ich lieber auf Büros. Ich brauche die Welt. Ich brauche die Menschen. Um ihnen zu begegnen und um zu strahlen.
Ich vermisse euch mit all euren Widersprüchen und eurer Unerwartbarkeit und wahrscheinlich sogar mit eurer latenten Nervigkeit. Es ist nobel, genügsam zu sein und wichtig, dankbar zu sein. Aber ich feiere die Abwesenheit menschlicher Seelen und geistiger Welten hier nicht als irgendwie doch verzichtbar ab. Und wenn’s weiter geht, könnt ihr ja trotzdem zwischendurch mal Yoga machen. Haltet durch.