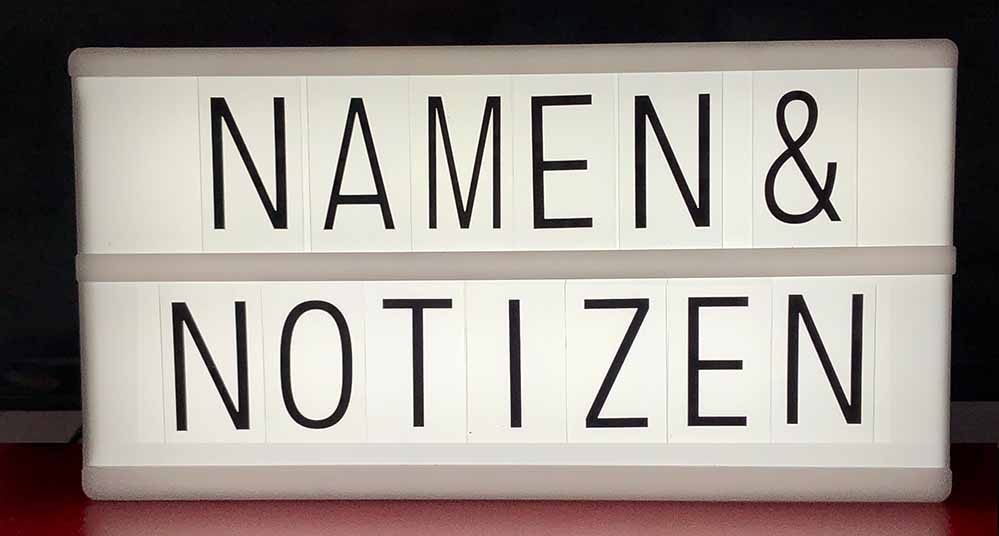Dortmund. Antisemitismus, antimuslimischer Rassismus und die Sehnsucht nach Verständigung: Die neue Theater-Performance „beyond the lines“ von Susanne Hocke und Jürgen Larys vom artENSEMBLE THEATER stellt Fragen, die schmerzen, doch gerade jetzt dringend gestellt werden müssen.
Am 8. November wurde das Stück in der Deutschen Auslandsgesellschaft Dortmund uraufgeführt. Gerade in einer Zeit, in der gesellschaftliche rote Linien gezogen werden zwischen Religionen, Kulturen und politischen Lagern, versucht das Stück, Brücken zu schlagen. Es fragt, ob ein gemeinsamer Raum jenseits von Krieg, Gewalt, Streit und Ausgrenzung denkbar ist. Der Text basiert auf intensiver Feldforschung. Hierfür haben die beiden Schauspieler Gespräche mit jüdischen, muslimischen und christlichen Gemeinden, mit Wissenschaftlern, Aktivisten und von Rassismus und Diskriminierung betroffenen Menschen geführt. Entstanden ist daraus eine vielstimmige Collage aus Erzählungen, historischen Dokumenten, aktuellen Nachrichten und poetischen Passagen.
Referenzpunkte des Stückes sind die rechtsextremen Anschläge auf die Synagoge in Halle (2019), auf Menschen mit Migrationshintergrund in Hanau (2020) und der aktuelle Krieg in Israel und Palästina. Die Performance beleuchtet, wie eng Antisemitismus und antimuslimischer Rassismus miteinander verflochten sind und wie alte Wunden seit dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 in neuen Formen aufbrechen.
„Grün war die Linie“, heißt es an einer Stelle, in Anspielung auf die Waffenstillstandslinie von 1949 zwischen Israel und Palästina. Doch „beyond the lines“ bleibt nicht bei der politischen Landkarte stehen. Das Stück fragt, wie solche Linien in Köpfen und Herzen fortbestehen und was nötig wäre, um sie zu überschreiten.
Mit diesem neuen Stück führen Susanne Hocke und Jürgen Larys ihre Arbeit an einer Trilogie fort, die sich mit Religion, Identität und Zusammenleben in einer pluralen Gesellschaft auseinandersetzt. 2019 verantworteten sie das Theaterprojekt „Weißt du, wer ich bin?“, das den Dialog zwischen Judentum, Christentum und Islam in den Mittelpunkt stellte und 2019 mit dem ersten Platz des Integrationspreises der Stadt Dortmund ausgezeichnet wurde. 2022 folgte der zweite Teil „Die Suche“, in dem Fragen nach Sinn, Orientierung und Zugehörigkeit aufgegriffen wurden. „Beyond the lines“ bildet nun den dritten Teil dieser Reihe und erweitert die Perspektive. Das Stück richtet den Blick auf gesellschaftliche Spannungen, Diskriminierung und die fragile Möglichkeit von Verständigung in Zeiten wachsender Polarisierung.
Im Nachgespräch erzählten Hocke und Larys in einem offenen Gespräch dem Publikum die Entstehungsgeschichte ihres Projekts. Sie seien nach Halle und Hanau gereist und hätten dort mit Überlebenden, Angehörigen und Engagierten gesprochen. Diese Begegnungen hätten sie „emotional sehr lange begleitet“ und deutlich gemacht, wie tief die Wunden sind, die rassistische und antisemitische Gewalt in den betroffenen Gemeinschaften hinterlässt. Besonders bewegend sei für sie gewesen, wie wenig die Mehrheitsgesellschaft den antimuslimischen Rassismus überhaupt wahrnimmt, obwohl er, wie Untersuchungen zeigen, die am weitesten verbreitete Form von Rassismus in Deutschland sei.
Die Zuschauer erhielten ebenso die Möglichkeit, ihre Eindrücke zu teilen. Durch das Gespräch wurde das Theater zu einem öffentlichen Diskursraum, der sich ständig verändert und erweitert. Ein Abend, der Verständigung erprobte und zeigte, dass jenseits der Linien vielleicht doch ein Raum existiert, wenn wir bereit sind, ihn gemeinsam zu betreten.
„Beyond the lines“ ist eine Kooperation der Jüdischen Kultusgemeinde Groß-Dortmund, der Evangelischen Lydia-Gemeinde Dortmund, der Islamischen Akademie NRW, der Auslandsgesellschaft.de und des Multikulturellen Forums. Gefördert wird das Projekt vom Bundesministerium des Innern.
„Beyond the lines“ wird in diesem Jahr noch in Frankfurt und Berlin aufgeführt. In 2026 wird das Stück sechsmal im Dietrich-Keuning-Haus (DKH) kostenlos speziell für Dortmunder Schulen gezeigt, die mit der Unterstützung der DSW 21 und der Dr. Buhmann Stiftung für interreligiöse Verständigung ermöglicht werden.